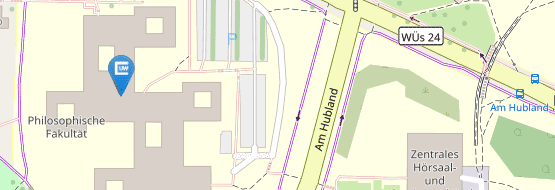Forschungsschwerpunkte
Der Lehrstuhl für deutsche Philologie der Universität Würzburg befasst sich im Kontext zahlreicher Forschungsprojekte mit ganz verschiedenen Themenfeldern der germanistischen Mediävistik. Grundlegende Forschungsbereiche sind dabei historische Übersetzungsforschung, Überlieferungsgeschichte, Aspekte der Materialität und Medialität, Poetik und Narratologie sowie Editionswissenschaft in ihren Kontaktbereichen zur Digitalität. Auch kulturwissenschaftliche Fragestellungen spielen eine besondere Rolle, ebenso wie die Vermittlung der mittelalterlichen Literatur an eine interessierte Öffentlichkeit. Der zeitliche Schwerpunkt der Forschung liegt auf den Literaturen des hohen und späten Mittelalter sowie der Frühen Neuzeit.
Kulturen des Übersetzens
Übersetzen ist eine ubiquitäre Kulturtechnik, doch was genau unter einer ‚Übersetzung‘ verstanden wird, ist abhängig von gesellschaftlichen, kulturellen und zum Teil individuellen Faktoren, ebenso wie von historischen Kontexten. Am Lehrstuhl für deutsche Philologie nehmen wir Übersetzungen und Übersetzende aus Mittelalter und Früher Neuzeit in den Blick, um Transformationsprozesse textueller, literarischer oder medialer Art auf ihre Spezifik hin zu untersuchen. Durch die Erforschung der ‚Kulturen des Übersetzens‘ wird die Vielfalt von Übersetzungspraktiken sichtbar. Deutlich wird jedoch auch, dass die Erforschung des Übersetzens als kultureller Technik den Blick für Probleme bisheriger Epochenzuschreibungen oder Gattungszuordnungen schärfen kann.
-
DFG-Schwerpunktprogramm 2130: Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit (1450–1800) (Regina Toepfer, Peter Burschel, Jörg Wesche, koordinierende Mitarbeiterin: Annkathrin Koppers) (2018–2024)
-
DFG-Projekt: Translationsanthropologie. Deutsche Antikenübersetzungen des 16. Jahrhunderts aus der Perspektive der Intersektionalitätsforschung (Regina Toepfer, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: Jennifer Hagedorn, Rahel Micklich) (2021–2024)
-
DFG-Projekt: Translationsanthropologie. Die deutschen Homer- und Ovid-Übersetzungen des 16. Jahrhunderts aus der Perspektive der Intersektionalitätsforschung (Regina Toepfer, wissenschaftliche Mitarbeiterin: Jennifer Hagedorn) (2018–2021)
-
Dissertationsprojekt (Jennifer Hagedorn): Übersetzte Identitäten. Intersektionale Figurenkonzepte in volkssprachigen Homer-Übersetzungen des 16. Jahrhunderts (abgeschlossen 2023)
-
Wissenschaftliches Netzwerk: Humanistische Antikenübersetzung und frühneuzeitliche Poetik in Deutschland (1450–1620) (Regina Toepfer, Johannes Klaus Kipf) (2012–2016)
Digitalität und Editionswissenschaft
Mit der zunehmenden Digitalisierung aller Bereiche des Lebens gerät eine Vielzahl technischer Möglichkeiten in den Blick, philologische Themenfelder auch digital zu bearbeiten und bisher gestellte Forschungsfragen weiterzuentwickeln. Am Lehrstuhl für deutsche Philologie bereiten wir mittelalterliche und frühneuzeitliche Texte in digitalen Editionen auf, die nicht nur als Ergänzung traditioneller Editionen zu denken sind, sondern technische Verfahren nutzen, um ganz neue Formen der Texterschließung und innovative philologische Zugänge zu ermöglichen.
-
DFG-Projekt: Narragonia Latina. Hybridedition der lateinischen ‚Narrenschiffe‘ von Jakob Locher (1497) und Jodocus Badius (1505) (Joachim Hamm, Thomas Baier) (2021–2024)
-
DFG-Projekt: Camerarius digital (Joachim Hamm, Thomas Baier, Norbert Fischer, Marion Gindhart, Frank Puppe, Christian Reul, Ulrich Schlegelmilch) (2021–2024)
-
Automatische Texterkennung mittelalterlicher Handschriften (Stefan Tomasek, Maximilian Wehner) (seit 2021)
-
Digitale Neuedition der ‚Kindheit Jesu‘ Konrads von Fußesbrunnen (Stefan Tomasek) (seit 2018)
-
Reinbot von Durne: Der Heilige Georg: Mittelhochdeutscher Text, Übersetzung, Kommentar und Materialien zur Stofftradition. Hrsg. von Christian Buhr, Astrid Lemke und Michael R. Ott. Berlin 2020.
-
DFG-Projekt: Opera Camerarii. Eine semantische Datenbank zu den gedruckten Werken von Joachim Camerarius d. Ä. (1500–1574) (Joachim Hamm, Thomas Baier, Frank Puppe, Ulrich Schlegelmilch) (2016–2019)
-
BMBF-Projekt: Narragonien digital. Eine digitale Edition europäischer Ausgaben von Sebastian Brants ‚Narrenschiff‘ (1494) (Joachim Hamm, Brigitte Burrichter) (2014–2019)
Poetische Spielräume
Im Rahmen vielfältiger poetologischer wie narratologischer Untersuchungen werden am Lehrstuhl für deutsche Philologie die ‚poetischen Spielräume‘ mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Texte erforscht. Aus literatur- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven untersuchen wir etwa klassische hochmittelalterliche Gattungen wie den höfischen Roman und die Liebeslyrik, wenden uns jedoch auch geistlichen, satirischen oder enzyklopädischen Texten zu. Sichtbar gemacht werden so die vielfältigen literarischen Konstruktionen, Imaginationen und Welten der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters.
-
Publikationsprojekt (Stefan Tomasek): ‚Minne, lâ mich vrî!‘. Untersuchungen zur deutschen Kreuzzugslyrik des zwölften Jahrhunderts (in Vorbereitung)
-
Habilitationsprojekt (Christian Buhr): Die Schiffbrüchigen – Literarische Katastrophendiskurse im europäischen Mittelalter
-
Habilitationsprojekt (Stefan Tomasek): ‚Pseudo-Matthäus‘ mittelhochdeutsch: Bruder Wernhers ‚Driu liet von der maget‘ und Konrads von Fußesbrunnen ‚Kindheit Jesu‘
-
Dissertationsprojekt (Bianca Waldmann): Literatur als (Medium der) Erfahrung – Narrativität und Imagination in mittelhochdeutschen Erzähltexten
-
Dissertationsprojekt (Maximilian Wehner): Narragonischer Raum. Studien zu Sebastian Brants ‚Narrenschiff‘, ausgewählten Bearbeitungen und einem belehrenden Programm der Räumlichkeit
-
Dissertationsprojekt (Manuel Hoder): Wortgewandte Wappen. Inszenierungsformen des Heraldischen in der deutschen Literatur des Mittelalters (abgeschlossen 2022)
Gender Studies
Strukturen der Macht, Prozesse der Privilegierung und Marginalisierung, die Zuschreibung und das Aushandeln von Identitäten spielen in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit eine ebenso entscheidende Rolle wie in der Gegenwart. Am Lehrstuhl für deutsche Philologie historisieren wir theoretische Zugänge aus den Gender und Queer Studies, um Kategorien wie Geschlecht, Stand, Alter, Sexualität und Körper in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Texten zu untersuchen, zu beschreiben und in ihren übergreifenden kulturhistorischen Zusammenhängen zu verstehen.
-
Publikationsprojekt (Regina Toepfer, Jörg Wesche, Annkathrin Koppers): Gender und Diversität in den Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit (in Vorbereitung)
-
Dissertationsprojekt (Alyssa Steiner): Text, Bild, Geschlecht: Sebastian Brants Narrenkonzeption und deren Transformationen bei Thomas Murner und Johann Geiler von Kaysersberg in genderspezifischer Perspektive
-
Dissertationsprojekt (Lea Steinfeld): Männlichkeitskonstruktionen im mittelhochdeutschen Antikenroman
-
Dissertationsprojekt (Markus Nolda): Gender und Moraldidaxe. Zur Konstruktion von Geschlecht im ‚Welschen Gast‘ und den ‚Winsbeckischen Gedichten‘ (abgeschlossen 2023)
-
Themenheft der Zeitschrift ‚Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung‘: Kinderlosigkeit im Mittelalter (Regina Toepfer, Bettina Wahrig) (2021/2)
-
Opus Magnum: Kinderlosigkeit. Geschichte der Un/Fruchtbarkeit in Mittelalter und Früher Neuzeit (Regina Toepfer) (2018–2019, erschienen 2020)
Medialität und Performativität
Mediale Dimensionen wie die verschiedener Formen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit innerhalb von Literatur, Wechselwirkungen bspw. zwischen Texten und Bildern oder auch Fragen literarischer Kommunikation und Wahrnehmung nehmen in der Erforschung mittelalterlicher wie frühneuzeitlicher Literaturen einen immensen Stellenwert ein. In welchem Zusammenhang diese entsprechend vielfältigen Sprachhandlungen zum Forschungsfeld literarischer Performativität stehen, untersuchen wir am Lehrstuhl für deutsche Philologie in verschiedenen Forschungsprojekten.
-
DT16 Digital: Drama und Theater des 16. Jahrhunderts digital (Regina Toepfer, in Planung)
-
Dissertationsprojekt (Laura Dürschmied): Der teütsch Cicero. Autorinszenierung als intermedial vermittelter Lebens-Bild-Entwurf bei Johann von Schwarzenberg
-
Dissertationsprojekt (Felix Herberth): Überlieferungsgeschichte und Autorschaftskonzept von Johannes Hartliebs ‚Histori von dem großen Alexander‘
-
Dissertationsprojekt (Christine Grundig): Autorschaft, Medialität und Überlieferungsgeschichte in ‚Narrenschiffen‘ des 15. und frühen 16. Jahrhunderts (abgeschlossen 2022)
-
Mittelalterrezeption im Musiktheater. Ein stoffgeschichtliches Handbuch. Hrsg. von Christian Buhr, Michael Waltenberger und Bernd Zegowitz. Berlin 2021.
-
Tagungsprojekt plus: Ambivalenzen des geistlichen Spiels (Regina Toepfer, Jörn Bockmann) (2016–2018)
Mittelalter vermitteln in Schule und Gesellschaft
Die Bedeutung mittelalterliche Themen für die Gegenwart zu verdeutlichen und – im Sinne der Third Mission der Universitäten – in der Gesellschaft zu vermitteln, ist ein wichtiges Anliegen des Lehrstuhls für deutsche Philologie. In verschiedenen Projekten werden Themen der germanistischen Mediävistik so aufbereitet, dass sie einer außeruniversitären Öffentlichkeit präsentiert oder an Schulen vermittelt werden können. Im Fokus steht dabei auch die Vielfalt der Vermittlungsmethoden: So werden neben klassischen Buchprojekten auch neue digitale Medien und Formate wie Apps oder Podcasts genutzt, um Interessierten mediävistische Themen nahezubringen.
-
Würzburger Literatur-App (Stefan Tomasek) (seit 2023)
-
Podcast ‚Kapselwurf‘ (Jennifer Hagedorn) (seit 2020)
-
Kooperationen mit Würzburger Schulen (Stefan Tomasek) (seit 2012)
-
Organisation zahlreicher Ringvorlesungen und Herausgabe mehrerer Bände der Reihe ‚Würzburger Ringvorlesungen‘ und ‚Publikationen des Kollegs Mittelalter und Frühe Neuzeit‘ (Dorothea Klein, Joachim Hamm) (seit 2011)
-
Mitherausgeberschaft von Mediaevum.de – Das altgermanistische Internetportal (Joachim Hamm) (seit 1999)
-
150-jähriges Jubiläum des Instituts für deutsche Philologie (2023)
-
Themenheft der Zeitschrift ‚Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung‘: Mediävistik 2021. Positionen, Strategien, Visionen (Wolfram Drews, Matthias Müller, Regina Toepfer) (2021/1)
-
Virtuelle Ausstellung des SPP 2130: Übersetzen ist Macht. Geheimnisse – Geschenke – Geschichten (Annkathrin Koppers) (2021)