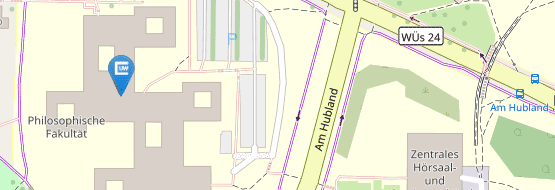Prof. Dr. Regina Toepfer

Lehrstuhlinhaberin
Philosophische Fakultät
Institut für deutsche Philologie
Lehrstuhl für deutsche Philologie, Ältere Abteilung
Am Hubland
97074 Würzburg
Raum 4 E 8
Tel.: +49 931 31 83609
E-Mail: regina.toepfer@uni-wuerzburg.de
In Forschung und Lehre, als Sprecherin des DFG-Schwerpunktprogramms 2130 'Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit', bei der Nachwuchsförderung, der Lehramtsausbildung und der Wissenschaftskommunikation betreibe ich eine zukunftsorientierte Mediävistik. Dies bedeutet, philologische und kulturwissenschaftliche Ansätze zu verbinden, wichtige Themen der Gegenwart zu historisieren, aus mittelalterlichen Narrativen auf heutige Prägungen und künftige Veränderungen zu schließen, mit Studierenden, Promovierenden und Postdocs über aktuelle Forschungsfragen zu diskutieren, innovative digitale Lehrprojekte zu entwickeln und mit den anderen Abteilungen der Germanistik wie mit den mediävistischen Schwesterdisziplinen zu kooperieren.
I am Chair of Medieval German Studies at Julius-Maximilians-Universität Würzburg and President of the Mediävistenverband (Society of Medieval Studies). Our purpose is to research and teach the language, literature, and culture of the German Middle Ages from 800 to 1600. We help gain access to cultural heritage and contribute to expanding current scholarly discourses on language, literature, and culture to include a historical perspective.
My research interests encompass translation history, narratology, gender studies, and comparative studies in historical contexts. I began studying translation history in my PhD project, in which I examined the reception of the Greek church father Basil of Caesarea in Germany in the fifteenth and sixteenth centuries. From 2012 to 2016, in a project funded by the DFG (German Research Foundation), I organized a network of scholars devoted to studying humanist translations of ancient texts and Early Modern poetics in Germany. Since 2018 I have acted as spokesperson of the DFG Priority Programme 2130 Early Modern Translation Cultures. Our aim is the interdisciplinary study of the epoch-making significance of concepts and practices of translation as a central and ubiquitous cultural technique of Early Modern times (1450–1800) and, in conjunction with that, a reorientation of the cultural sciences drawing on the current translational turn. In my individual SPP 2130 project, “Translational Anthropology”, my team and I are inquiring into sixteenth-century German translations of ancient literature from the perspective of intersectionality research. We consider translations key anthropological texts that – produced by humans for humans – negotiate human matters.
I recently published the study Infertility in Medieval and Early Modern Europe: Premodern Views on Childlessness (Palgrave Macmillan, 2022). There I propose that infertility is not only a biological category, but also a social construct. Having investigated the theological, medical, legal, demonical, and ethical discussions on infertility in premodern times, I am currently revising a book on how medieval literature negotiates childlessness and parenthood for an English publication by ARC Humanities Press. Both studies are based on my German monograph Kinderlosigkeit: Ersehnte, verweigerte und bereute Elternschaft (J.B. Metzler/Springer, 2020). I began work on this book after my habilitation, when I was a DFG-Heisenberg Fellow at Humboldt-University Berlin, and finished writing it with a grant from the Volkswagen Foundation’s Opus Magnum programme while serving as a professor at Technische Universität Braunschweig. My approach – comparative study in a historical context – will not only contribute to gaining a deeper understanding of the past, but also stimulate self-reflection and provide impulses for the future.
You will find more information about me and my projects in English on the following websites:
- Curriculum vitae https://www.academia-net.org/profile/regina-toepfer/78588
- Society of Medieval Studies https://www.mediaevistenverband.de/english/
- Priority Programme 2130 Early Modern Translation Cultures https://www.spp2130.de/index.php/en/welcome/
- Virtual exhibition of the Priority Programme 2130: Translation is Power: Secrets, Gifts, and Stories in the Early Modern Period https://uebersetzenistmacht.de/
- Current DFG project: Translational Anthropology: German Sixteenth-Century Translations of Ancient Literature from the Perspective of Intersectionality Research https://www.spp2130.de/index.php/en/translational-anthropologyii/
- GHIL Podcast, 'Homer’s Heroes in Early Modern Germany: A Translational Anthropology', GHIL Lecture, given 20 June 2023 (0.50h), https://www.ghil.ac.uk/publications/podcasts/homers-heroes-in-early-modern-germany
As is common for medievalists in German studies, I work primarily with sources written in Middle High and Early Modern German and my scientific language is Modern German. As an expert on translation history, I do not regard translation merely as a mechanical process but as a creative and hermeneutic act. As I thankfully have the opportunity to work with wonderful translators, some of my publications are also available in English.
-
Negotiating Childlessness in the Middle Ages: Stories of Desired, Refused, and Regretted Parenthood. Translated by Kate Sotejeff-Wilson. Leeds: Arc Humanities Press 2025. DOI: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/97214.
-
Early Modern Translation Research from an Intersectional Perspective: A Résumé. Translated by Judith Rosenthal. In: J. Hagedorn; R. Toepfer (eds.): Translation und Marginalisierung. Frühneuzeitliche Literatur aus intersektionaler Perspektive. Heidelberg; Berlin 2025 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 7), pp. 305-326. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69469-5_15.
-
Early Modern Translation Research from an Intersectional Perspective: An Invitation (by Regina Toepfer and Jennifer Hagedorn). Translated by Judith Rosenthal. In: J. Hagedorn; R. Toepfer (eds.): Translation und Marginalisierung. Frühneuzeitliche Literatur aus intersektionaler Perspektive. Heidelberg; Berlin 2025 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 7), pp. 19-36. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69469-5_2.
-
Translation and Subversion: Perspectives in Early Modern Research (by Jörg Wesche, Regina Toepfer, Peter Burschel), trans. Judith Rosenthal. In: J. Wesche, R. Toepfer, P. Burschel (eds.): Gegenläufigkeiten / Contrarieties. Subversives Übersetzen in der Frühen Neuzeit / Subversive Translation in the Early Modern Period Berlin, Heidelberg 2025 (Early Modern Translation Cultures 4), pp. 15-27. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69149-6_2.
-
Of Heroines and Housewives: How Johannes Spreng’s German Translation of the 'Metamorphoses' (1564) Conveys Gender-Specific Norms. Translated by Judith Rosenthal. In: A. Flüchter; A. Gipper; S. Greilich; HJ. Lüsebrink (Hgg.) Übersetzungspolitiken in der Frühen Neuzeit / Translation Policy and the Politics of Translation in the Early Modern Period. Berlin, Heidelberg 2024 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 3), pp. 105–123. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-67339-3_6.
- Ovid’s Poetry Serving Christian Doctrine: Johannes Spreng’s German Translation of the Metamorphoses from 1564, transl. Chris Abbey. In: K. Triplett (ed.): Translated Religion: In a Forest of True Words. Leipzig: Universität Leipzig Universitätsbibliothek, 2023, pp. 34–43. URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-845469 (accessed 24 August 2023).
- Infertility in Medieval and Early Modern Europe: Premodern Views on Childlessness, transl. Kate Sotejeff-Wilson. London: Palgrave Macmillan, 2022.
- Introduction to Section II: Anthropology and Knowledge, transl. Judith Rosenthal. In: Regina Toepfer, Peter Burschel, Jörg Wesche (eds.), Übersetzen in der Frühen Neuzeit – Konzepte und Methoden / Concepts and Practices of Translation in the Early Modern Period (Early Modern Translation Cultures 1). Berlin and Heidelberg: Springer, 2021, pp. 221–235. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62562-0_11 (accessed 24 August 2023).
- Introduction, transl. Judith Rosenthal. In: Regina Toepfer, Peter Burschel, Jörg Wesche (eds.), Übersetzen in der Frühen Neuzeit – Konzepte und Methoden / Concepts and Practices of Translation in the Early Modern Period (Early Modern Translation Cultures 1). Berlin, Heidelberg: Springer, 2021, pp. 29–55. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62562-0_2 (accessed 24 August 2023).
| seit 2023 | Präsidentin des Mediävistenverbands |
| 2022-2023 | Geschäftsführende Vorständin des Instituts für deutsche Philologie |
| 2021 | Berufung auf den Lehrstuhl für deutsche Philologie an der JMU Würzburg |
| 2019 | Aufnahme als ordentliches Mitglied in die Klasse für Geisteswissenschaften der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft |
| 2018-2019 | Opus magnum-Förderung der VolkswagenStiftung |
| seit 2018 | Sprecherin des DFG-Schwerpunktprogramms 2130 ‚Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit‘ |
| 2018 | Auszeichnung mit dem Wissenschaftspreis Niedersachsen in der Kategorie Lehre, gemeinsam mit Dr. Wiebke Ohlendorf |
| 2017-2021 | Schriftführerin des Mediävistenverbands und Herausgeberin der Zeitschrift ‚Das Mittelalter – Perspektiven mediävistischer Forschung‘ |
| 2016-2021 | Professorin für Germanistische Mediävistik an der TU Braunschweig |
| 2015 | Heisenberg-Stipendiatin an der Humboldt-Universität zu Berlin |
| 2014-2015 | Vertretung einer W3-Professur für Ältere deutsche Philologie und Gastprofessorin am SFB 933 ‚Materiale Textkulturen‘ der Universität Heidelberg |
| 2013 | Gastdozentur an der Universität Bern |
| 2012-2013 | Vertretung einer W3-Professur für Ältere deutsche Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin |
| 2011-2014 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Deutsche Literatur des Mittelalters an der Goethe-Universität Frankfurt |
| 2011 | Habilitation im Fach Germanistik unter besonderer Berücksichtigung der Älteren deutschen Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt |
| 2010-2011 | Vertretung einer W3-Professur für Ältere deutsche Literaturwissenschaft im europäischen Kontext an der Goethe-Universität Frankfurt |
| 2005-2010 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Deutsche Literatur des Mittelalters der Goethe-Universität Frankfurt |
| 2005 | Promotion in Deutscher Philologie (Ältere deutsche Sprache und Literatur) an der Georg-August-Universität Göttingen |
| 2001-2004 | Stipendiatin der International Max Planck Research School ‚Werte und Wertewandel in Mittelalter und Neuzeit‘ in Göttingen; Promotionsstudium ‚Mittelalter und Früheneuzeitstudien‘ an den Universitäten Göttingen und Basel |
| 2001 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters der Philipps-Universität Marburg, Mitarbeit bei der Vorbereitung des DFG-Projekts ‚Marburger Repertorium zur Übersetzungsliteratur im deutschen Frühhumanismus‘ |
| 1994-2001 | Studium der Germanistik, Theologie und Griechischen Philologie in Marburg (Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien) |
Forschungsschwerpunkte
|
|
Aktuelle Forschungsprojekte
| Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit (DFG-Schwerpunktprogramm 2130, Leitung mit Prof. Dr. Peter Burschel und Prof. Dr. Jörg Wesche). Nähere Informationen finden Sie hier. | |
 | Translationsanthropologie. Die deutschen Antikenübersetzungen des 16. Jahrhunderts aus der Perspektive der Intersektionalitätsforschung (DFG-Projekt im SPP 2130, bearbeitet von Jennifer Hagedorn und Rahel Micklich). Nähere Informationen finden Sie hier. |
In Vorbereitung befindliches Forschungsprojekt
Abgeschlossene Projekte
 | Opus Magnum-Projekt: Kinderlosigkeit. Geschichte der Un/fruchtbarkeit in Mittelalter und Früher Neuzeit (Buchprojekt, gefördert durch die VolkswagenStiftung). Nähere Informationen finden Sie hier. |
 | DFG-Projekt: Wissenschaftliches Netzwerk: Humanistische Antikenübersetzung und frühneuzeitliche Poetik in Deutschland (1450-1620), Organisation mit Dr. Johannes Klaus Kipf, Projektlaufzeit: 2012-2016. Nähere Informationen finden Sie hier. |
Abgeschlossene Tagungsprojekte
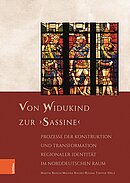 | Artus in Stade. Prozesse der Konstruktion und Transformation regionaler Identität im norddeutschen Raum – Tagung des Verbunds Mittelalter-Germanistik Nord im Kloster Wöltingerode, 31.05.-02.06.2018, Organisation mit Prof. Dr. Martin Baisch, Jun.-Prof. Dr. Julia Weitbrecht und PD Dr. Almut Schneider. |
 | Heil und Heilung. Die Kultur der Selbstsorge in der Kunst und Literatur des Mittelalters – Interdisziplinäre Tagung am Internationalen Wissenschaftsforum in Heidelberg, 13.-15. Oktober 2016, Organisation mit Prof. Dr. Tobias Bulang, gefördert von der Thyssen-Stiftung. |
 | Ambivalenzen des geistlichen Spiels. Re-Visionen von Texten und Methoden – Ein Projekt an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Schule und Kulturarbeit in Kooperation mit der Stadt Bad Gandersheim, den Gandersheimer Domfestspielen, dem Museum Portal zur Geschichte und dem Roswitha-Gymnasium (Bad Gandersheim), 16.-18. März 2016, Organisation mit PD Dr. Jörn Bockmann, gefördert von der Niedersächsischen Stiftung, der Braunschweigischen Stiftung und der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. |
Monographien
-
Negotiating Childlessness in the Middle Ages: Stories of Desired, Refused, and Regretted Parenthood. Translated by Kate Sotejeff-Wilson. Leeds: Arc Humanities Press 2025 (basierend auf dem überarbeiteten zweiten Teil von ‚Kinderlosigkeit‘, 2020). (238 S.) DOI: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/97214.
-
Infertility in Medieval and Early Modern Europe: Premodern Views on Childlessness. Translated by Kate Sotejeff-Wilson. London: Palgrave Macmillan 2022 (basierend auf dem überarbeiteten ersten Teil von ‚Kinderlosigkeit‘, 2020). (255 S.)
-
Translationsanthropologie. Philologische Übersetzungsforschung als Kulturwissenschaft. Mit einer exemplarischen Analyse der ersten deutschen Odyssee von Simon Schaidenreisser. Hannover 2022 (Neue Perspektiven der Frühneuzeitforschung 7). (72 S.)
-
Kinderlosigkeit. Ersehnte, verweigerte und bereute Elternschaft im Mittelalter. Stuttgart 2020. (510 S.)
-
Höfische Tragik. Motivierungsformen des Unglücks in mittelalterlichen Erzählungen. Berlin; Boston 2013 (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte 144). (510 S.)
-
Pädagogik, Polemik, Paränese. Zur deutschen Rezeption des Basilius Magnus im Humanismus und in der Reformationszeit. Tübingen 2007 (Frühe Neuzeit 123). (666 S.)
-
(als Regina Götz:) Der geschlechtliche Mensch - ein Ebenbild Gottes. Die Auslegung von Gen 1,27 durch die wichtigsten griechischen Kirchenväter. Frankfurt 2003 (Fuldaer Hochschulschriften 42). (152 S.)
Herausgeberschaften
-
mit J. Hagedorn (Hgg.): Translation und Marginalisierung. Frühneuzeitliche Literatur aus intersektionaler Perspektive. Heidelberg; Berlin 2025 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 7). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69469-5.
-
mit J. Wesche; P. Burschel (Hgg.): Gegenläufigkeiten / Contrarieties. Subversives Übersetzen in der Frühen Neuzeit / Subversive Translation in the Early Modern Period. Heidelberg; Berlin 2025 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 4). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69149-6.
-
mit B. Burrichter; B. Schmitz (Hgg.): 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Würzburg 2024 (Würzburger Ringvorlesungen 22).
-
mit M. Baisch; M. Ratzke (Hgg.): Von Widukind zur ‚Sassine‘. Prozesse der Konstruktion und Transformation regionaler Identität im norddeutschen Raum. Wien; Köln 2023 (Forschungen zu Kunst, Geschichte und Literatur des Mittelalters 4).
-
Klassiker der Frühen Neuzeit. Unter Mitwirkung von N. Lordick. Hildesheim 2022 (Spolia Berolinensia 43). DOI: https://doi.org/10.25716/amad-85489
-
mit P. Burschel; J. Wesche (Hgg.): Übersetzen in der Frühen Neuzeit – Konzepte und Methoden / Concepts and Practices of Translation in the Early Modern Period. Berlin, Heidelberg 2021 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 1). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62562-0
-
mit B. Wahrig: Kinderlosigkeit im Mittelalter. Heidelberg 2021 (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung 26/2). DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2021.2
-
mit W. Drews; M. Müller (Hgg.): Mediävistik 2021. Positionen, Strategien, Visionen. Heidelberg 2021 (Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung 26/1). DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2021.1 (290 S.)
-
mit T. Bulang (Hgg.): Heil und Heilung. die Kultur der Selbstsorge in der Kunst und Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Heidelberg 2020 (GRM Beiheft 95). (282 S.)
-
Klassiker des Mittelalters. Hildesheim 2019 (Spolia Berolinensia 38). DOI: http://dx.doi.org/10.25716/amad-85194 (312 S.)
-
mit J. Bockmann: Ambivalenzen des geistlichen Spiels. Revisionen von Texten und Methoden. Göttingen 2018 (Historische Semantik 29). (362 S.)
-
Tragik und Minne. Heidelberg 2017 (Studien zur Literatur und Erkenntnis 12). (261 S.)
-
mit T. Terrahe; J. Wolf (Hgg.): Christa Bertelsmeier-Kierst: Buchkultur und Überlieferung im kulturellen Kontext. Berlin 2017 (Philologische Studien und Quellen 262). (363 S.)
-
mit K. Kipf; J. Robert (Hgg.): Humanistische Antikenübersetzung und frühneuzeitliche Poetik in Deutschland (1450-1620). Berlin; Boston 2017 (Frühe Neuzeit 211). (584 S.)
-
mit G. Radke-Uhlmann (Hgg.): Tragik vor der Moderne. Literaturwissenschaftliche Analyse. Heidelberg 2015 (Studien zur Literatur und Erkenntnis 6). (354 S.)
-
mit R. Seidel (Hgg.): Frankfurt im Schnittpunkt der Diskurse. Strategien und Institutionen literarischer Kommunikation im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Frankfurt 2010 (Zeitsprünge 14). (418 S.)
-
mit C. Emmelius; F. Freise; R. v. Mallinckrodt; P. Paschinger; C. Sittig (Hgg.): Offen und Verborgen. Vorstellungen und Praktiken des Öffentlichen und Privaten in Mittelalter und Früher Neuzeit. Göttingen 2004. (288 S.)
Andere Literatur
-
Ulrike Draesner, Annkathrin Koppers, Regina Toepfer und Jörg Wesche (Hgg.): Übersetzen ist Macht. Essays zur Frühen Neuzeit. Hannover 2023. (160 S.)
-
Carolin Bohn; Thomas Meinecke; Regina Toepfer; Bettina Wahrig: Ozeanisch schreiben. Drei Ensembles zu einer Poetik des Nicht-Binären. Berlin 2022. (160 S.)
Aufsätze
Übersetzungsliteratur
-
Frühneuzeitliche Übersetzungsforschung aus intersektionaler Perspektive. Eine Bilanz. In: J. Hagedorn; R. Toepfer (Hgg.): Translation und Marginalisierung. Frühneuzeitliche Literatur aus intersektionaler Perspektive. Heidelberg; Berlin 2025 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 7), S. 281-303. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69469-5_14.
-
(mit J. Hagedorn): Frühneuzeitliche Übersetzungsforschung aus intersektionaler Perspektive. Eine Einladung. In: J. Hagedorn; R. Toepfer (Hgg.): Translation und Marginalisierung. Frühneuzeitliche Literatur aus intersektionaler Perspektive. Heidelberg; Berlin 2025 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 7), S. 1-18. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-69469-5_1.
-
Übersetzungsreflexion und Übersetzungsanalyse als Zukunftsaufgaben germanistischer Mediävistik. Gottfrieds Tristan aus translationswissenschaftlicher Perspektive. In: GRM 73 (2023), S. 1-20.
-
Klassikerfrage und Kanonkritik. Perspektiven frühneuzeitlicher Übersetzungsforschung. In: R. Toepfer (Hg.): Klassiker der Frühen Neuzeit. Unter Mitwirkung von N. Lordick. Hildesheim 2022 (Spolia Berolinensia 43), S. 1-31. DOI: https://doi.org/10.25716/amad-85471.
-
Sektionseinleitung. Anthropologie und Wissen. In: R. Toepfer; P. Burschel; J. Wesche (Hgg.): Übersetzen in der Frühen Neuzeit – Konzepte und Methoden / Concepts and Practices of Translation in the Early Modern Period. Berlin, Heidelberg 2021 (Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 1), S. 205-219. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62562-0_10.
Introduction to Section II: Anthropology and Knowledge, transl. by Judith Rosenthal. In: ebd., S. 221-235. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62562-0_11. -
mit P. Burschel u. J. Wesche: Einleitung. In: R. Toepfer; P. Burschel; J. Wesche (Hgg.): Übersetzen in der Frühen Neuzeit – Konzepte und Methoden / Concepts and Practices of Translation in the Early Modern Period. Berlin, Heidelberg 2021(Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit 1), S. 1-27. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62562-0_1. Introduction, transl. by Judith Rosenthal. In: ebd., S. 29-55. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-62562-0_2.
-
Medialität der Metrik. Eine Königsberger Bildungskontroverse um 1580 im Spiegel der Kasualdichtung. In: J. Keßler; U. Kundert; J. Oosterman (Hgg.): Controversial Poetry 1400–1600. Leiden 2020 (Radboud Studies in Humanities 11), S. 231-256. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004291911_011.
-
(mit J. K. Kipf und J. Robert): Einleitung: Humanistische Antikenübersetzung und frühneuzeitliche Poetik in Deutschland (1450-1620). In: R. Toepfer; J. K. Kipf; J. Robert (Hgg.): Humanistische Antikenübersetzung und frühneuzeitliche Poetik in Deutschland (1450-1620). Berlin; Boston 2017 (Frühe Neuzeit 211), S. 1-24.
-
Antike Historiographie im deutschen Südwesten. Das Übersetzungswerk Hieronymus Boners. In: F. Fuchs; G. Litz (Hgg.): Humanismus im deutschen Südwesten. Wiesbaden 2015 (Pirckheimer Jahrbuch 29), S. 37-60.
-
Kritische Erasmus-Rezeption. Heinrich von Eppendorfs deutsche Übersetzung der ‘Apophthegmata’ und das ‘Pariser Reformationsspiel’ von 1524. In: C. Galle; T. Sarx (Hgg.): Erasmus-Rezeption im 16. Jahrhundert. Frankfurt a.M. u.a. 2012 (Kulturgeschichtliche Beiträge zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit 5), S. 109-132.
-
„Feci novum!“ Zur Poetik von Thomas Naogeorgs Hamanus-Tragödie und ihrer deutschen Übersetzung von Johannes Chryseus. In: J.-D. Müller; U. Pfisterer u.a. (Hgg.): Aemulatio. Kulturen des Wettstreits in Text und Bild (1450-1620). Berlin; New York 2011 (Pluralisierung & Autorität 27), S. 449-485.
-
Predigtrezeption aus historisch-mediologischer Perspektive. Deutsche Übersetzungen griechischer Kirchenväter im Buchdruck des 16. Jahrhunderts. In: R. Wetzel; F. Flückiger (Hgg.): Die Predigt im Mittelalter zwischen Mündlichkeit, Bildlichkeit und Schriftlichkeit. Zürich 2010 (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 13), S. 37-65.
-
Mäzenatentum in Zeiten des Medienwechsels. Kaiser Maximilian I. als Widmungsadressat humanistischer Werke. In: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 17 (2008/2009), S. 79-92.
-
Konfessionelle Übertragungen. Zur volkssprachlichen Rezeption des Kirchenvaters Basilius Magnus im 16. Jahrhundert. In: K. von Greyerz; Th. Kaufmann; A. Schubert (Hgg.): Frühneuzeitliche Konfessionskulturen. Gütersloh 2008 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 207), S. 119-136.
Antikenrezeption
-
Saint Basile à l’époque de la réforme: La reception des écrits ascétiques dans l’espace Germanophone. Traduit par Olivier Delouis. In: O. Delouis; A. Peters-Custot (Hg.): Basile de Césarée. Une postérité monastique pour l’Europe. Paris 2024 (Théologie Historique 140), p. 223-244.
-
Ovids Dichtung im Dienst christlicher Glaubenslehre. Johannes Sprengs deutsche Metamorphosen-Übersetzung von 1564. In: Katja Triplett (Hg.): Übersetzte Religionen. Im Dickicht der wahren Worte. Leipzig 2021, S. 21-25, Abb. 18-20.
-
Ovid und Homer in ‚teutschen Reymen‘. Zur Bedeutung humanistischer Antikenübersetzungen für die Versepik der Frühen Neuzeit. In: Daphnis 46 (2018), S. 85-111.
-
Heliodor-Rezeption im deutschen Drama des 17. Jahrhunderts. Der Gattungstransfer der Aithiopica durch Caspar Brülow und Johann Joseph Beckh. In: Ch. Rivoletti; S. Seeber (Hgg.): Heliodorus redivivus. Vernetzung und interkultureller Kontext in der europäischen ‚Aithiopika‘-Rezeption der Frühen Neuzeit. Stuttgart 2018 (Palingenesia 112), S. 183-205.
-
Veranschaulichungspoetik in der frühneuhochdeutschen Ovid-Rezeption. Philomelas Metamorphosen bei Wickram, Spreng und Posthius. In: R. Toepfer; J. K. Kipf; J. Robert (Hgg.): Humanistische Antikenübersetzung und frühneuzeitliche Poetik in Deutschland (1450-1620). Berlin; Boston 2017 (Frühe Neuzeit 211), S. 383-407.
-
Vom Liebesverbot zum Leseverbot. Die deutsche Rezeption von Pyramus und Thisbe in Mittelalter und Früher Neuzeit. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik / Reihe A 120 (2015), S. 211-234.
-
Poesie statt Historiographie. Die Rehabilitierung Homers in der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts. In: Text + Kritik Sonderband VIII/10: „Homer und die deutsche Literatur“ (2010), S. 79-89.
-
‚inn vnserer sprach von new gleich erst geboren’. Deutsche Homer-Rezeption und frühneuzeitliche Poetologie. In: Euphorion 103 (2009), S. 103-130.
-
Humanistische Lektüre an der Universität Leipzig. Zur Funktionalisierung von Basilius Magnus’ Ad adolescentes in der Auseinandersetzung um die studia humanitatis. In: E. Bünz; F. Fuchs (Hgg.): Der Humanismus an der Universität Leipzig. Wiesbaden 2008 (Pirckheimer Jahrbuch 23), S. 105-127.
-
‚Mit fleiß zů Teütsch tranßferiert’. Schaidenreissers ‚Odyssea’ im Kontext der humanistischen Homer-Rezeption. In: B. Bußmann; A. Hausmann; u.a. (Hgg.): Übertragungen. Formen und Konzepte von Reproduktion in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin; New York 2005 (Trends in Medieval Philology 5), S. 329-348.
-
Von der öffentlichen Vorlesung zur Privatlektüre. Der Wandel des humanistischen Bestsellers ‚Ad adolescentes’ des Basilius Magnus in Verwendung und Verfügbarkeit. In: Offen und Verborgen 2004, S. 269-285.
Formen des Tragischen
-
Von der Kunst des Liebens zum Affekt des Tragischen. Die Beziehung von Paris und Helena in Ovids Heroides und Konrads von Würzburg Trojanerkrieg. In: R. Toepfer (Hg.): Tragik und Minne. Heidelberg 2017 (Studien zur Literatur und Erkenntnis 12), S. 177-206.
-
Einleitung: Tragik und Minne in Forschung, Theorie und Literatur. In: R. Toepfer (Hg.): Tragik und Minne. Heidelberg 2017 (Studien zur Literatur und Erkenntnis 12), S. 1-25.
-
Tragödientheorie und Narratologie. Die anonyme mittelhochdeutsche Versnovelle Hero und Leander. In: Mythos No. 4 (2016), S. 187-201.
-
(gemeinsam mit G. Radke-Uhlmann): Einleitung. Tragik vor der Moderne. In: dies. (Hgg.): Tragik vor der Moderne. Literaturwissenschaftliche Analyse. Heidelberg 2015 (Studien zur Literatur und Erkenntnis 6), S. 3-26.
-
‚So voll Zorns / daß alle vernunfft vom ihm schied.’ Handlungsmotivation und Tragikkonzept in der ‚Melusine’ des Thüring von Ringoltingen. In: R. Toepfer; G. Radke-Uhlmann (Hgg.): Tragik vor der Moderne. Literaturwissenschaftliche Analyse. Heidelberg 2015 (Studien zur Literatur und Erkenntnis 6), S. 286-315.
-
Biblische Tragödie. Die Enthauptung Johannes des Täufers in den Dramen Johannes Aals, Hans Sachs’ und Simon Gerengels. In: M. Eikelmann; U. Friedrich (Hgg.): Praktiken europäischer Traditionsbildung im Mittelalter. Wissen – Literatur – Mythos. Berlin 2013, S. 161-184.
-
Die Passion Christi als tragisches Spiel. Plädoyer für einen poetologischen Tragikbegriff in der Mediävistik. In: Th. Anz; H. Kaulen (Hgg.): Literatur als Spiel. Evolutionsbiologische, ästhetische und pädagogische Aspekte. Berlin; New York 2009 (spectrum Literaturwissenschaft 22), S. 159-175.
Vormodernes Theater
-
Kinderwunsch und Elternliebe im Theater der Reformationszeit. Abrahams Familiendrama bei Hans Sachs (1558), Andreas Lucas (1551) und Hermann Haberer (1562). In: Ebernburg-Hefte 56 (2022), S. 23-50 (= Blätter für pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde 89 (2022), S. 255-282.
-
Kindel, Wiege, Windel. Zur Interaktion mit sakralen Objekten in Weihnachtsritualen und Weihnachtsspielen. In: European Medieval Drama 25 (2021), S. 119-141.
-
(mit J. Bockmann): Einleitung: Ein Paradigma auf dem Prüfstand. Forschungsbilanz, Begriffsreflexion und Analysepotential des Ambivalenzkonzepts. In: dies. (Hgg.): Ambivalenzen des geistlichen Spiels. Revisionen von Texten und Methoden. Göttingen 2018 (Historische Semantik 29), S. 11-33.
-
Theater und Text in der Frühen Neuzeit. Impulse des überlieferungsgeschichtlichen Konzepts für die Dramenforschung. In: D. Klein in Verbindung mit H. Brunner; F. Löser (Hg.): Überlieferungsgeschichte transdisziplinär. Neue Perspektiven auf ein germanistisches Forschungsparadigma. Wiesbaden 2016 (Wissensliteratur im Mittelalter 52), S. 337-352.
-
Fiktivität und Faktizität im neulateinischen Drama. Das Karlsbild in Nicodemus Frischlins ‚Hildegardis Magna‘. In: D. Klein; F. Fuchs (Hgg.): Karlsbilder in Kunst, Literatur und Wissenschaft. Würzburg 2015 (Rezeptionskulturen in Literatur- und Mediengeschichte 1), S. 191-210.
-
Herodes und sein Narr. Karnevaleske Elemente in den Johannesspielen von Johannes Aal (1545), Daniel Walther (1558) und Johannes Sanders (1588). In: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 20 (2014/2015), S. 424-439.
-
Gewalt im reformatorischen Bibeldrama. Zur Tragedia / von Stephano dem heiligen marterer von Michael Sachs (1565). In: C. Dietl; C. Schanze; G. Ehrstine (Hgg.): Power and Violence in Medieval and Early Modern Theater. Göttingen 2014, S. 215-237.
-
Das Leiden Christi in Farbe. Zur Funktion der Bühnenanweisungen im ‚Donaueschinger Passionsspiel’. In: I. Bennewitz; A. Schindler (Hgg.): Farbe im Mittelalter. Materialität – Medialität – Semantik. Berlin 2011, S. 767-780.
-
Frühneuzeitliche Wende auf der Frankfurter Bühne? Das ‚Frankfurter Passionsspiel‘ und Paul Rebhuns ‚Susanna’ zwischen Theater und Kult. In: Zeitsprünge 14 (2010), S. 137-161.
-
Implizite Performativität. Zum medialen Status des Donaueschinger Passionsspiels. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 131 (2009), S. 106-132.
Gender Studies
-
Trost und Trostlosigkeit durch Kinderwunschgebete. Die Ambivalenz der Seelsorge für unfruchtbare Frauen in der Frühen Neuzeit. In: T. Bulang (Hg.): Trost. Zusammenhalt, Zuspruch und Trostgründe in der Krise. Heidelberg 2023 (GRM Beihefte 109), S. 125-147.
-
mit B. Wahrig: Einleitung. Die Komplexität und Diversität von Kinderlosigkeit im Mittelalter. In: Das Mittelalter 26 (2021), S. 291-310. DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2021.2.24445.
-
Fertilität und Macht. Die Reproduktionspflicht mittelalterlicher Herrscherinnen und Herrscher. In: A. Stieldorf; L. Dohmen; I. Dumitrescu, L. D. Morenz (Hgg.): Geschlecht macht Herrschaft – Interdisziplinäre Studien zu vormoderner Macht und Herrschaft. /Gender Powers Sovereignty – Interdisciplinary Studies on Premodern Power. Göttingen 2021 (Macht und Herrschaft 15), S. 175-199.
-
Von Heroinen und ‚Hausfrawen‘. Genderspezifische Normenvermittlung in Johannes Sprengs deutscher Metamorphosen-Übersetzung (1564). In: A. Schindler (Hg.): Mediävistische Perspektiven im 21. Jahrhundert. Festschrift für Ingrid Bennewitz zum 65. Geburtstag. Wiesbaden 2021, S. 99-111.
-
Kinderwunschrezepte. Mittelalterliche und moderne Reproduktionsmedizin im Vergleich. In: Jahrbuch 2020 der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Braunschweig 2021, S. 325–334. DOI: https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202109031206-0.
-
Junge oder Mädchen? Gender Trouble im ‚Roman de Silence‘. In: I. Bozkaya; B. Bußmann; K. Philipowski (Hgg.): Der Ritter, der ein Mädchen war. Studien zum Roman de Silence von Heldris de Cornouailles. Göttingen 2020 (Aventiuren 13), S. 215-231.
-
Kinderlos werden. Annas und Joachims Diskriminierung im Protevangelium des Jakobus und in den Marienleben des Priesters Wernher und Wernhers des Schweizers. In: I. Bennewitz; J. Eming; J. Traulsen (Hgg.): Gender Studies – Queer Studies – Intersektionalität. Eine Zwischenbilanz aus mediävistischer Perspektive. Göttingen 2019 (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung 25), S. 245-268.
-
Erbauung und Begehren. Spannungen im Dramenbuch Hrotsviths von Gandersheim. In: S. Köbele; C. Notz: Die Versuchung der schönen Form. Spannungen in ‚Erbauungs‘-Konzept des Mittelalters. Göttingen 2019 (Historische Semantik 30), S. 91-113.
-
Vom marginalisierten Heiligen zum hegemonialen Hausvater. Josephs Männlichkeit im Hessischen und in Heinrich Knausts Weihnachtsspiel. In: European Medieval Drama 17 (2013) [Erschienen 2016], S. 43-68.
-
Der Eheteufel auf der Hochzeit zu Cana. Paul Rebhuns dramatisierte Geschlechterordnung. In: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 56 (2015), S. 137-159.
-
Die Frauen von Bechelaren. Stand, Herkunft und Geschlecht im Nibelungenlied sowie in Thea von Harbous Nibelungenbuch und in Fritz Langs Film Die Nibelungen. In: N. Bedeković; A. Kraß; A. Lembke (Hgg.): Durchkreuzte Helden. Das „Nibelungenlied“ und Fritz Langs Film „Die Nibelungen“ im Licht der Intersektionalitätsforschung. Bielefeld 2014, S. 211-238.
Heldenepik
-
Dietlinds Wahrheitssuche. Grundzüge einer nibelungischen Hermeneutik. In: J. Keller; F. Kragl, S. Müller (Hgg.): 13. und 14. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Die Nibelungenklage. Rüdiger von Bern. Wien 2019 (Philologica Germanica 39), S. 167-193.
-
Sympathie und Tragik. Rezeptionslenkung im Hildebrandslied. In: F. M. Dimpel; H. R. Velten (Hgg.): Techniken der Sympathiesteuerung in Erzähltexten der Vormoderne. Potentiale und Probleme. Heidelberg 2016 (Studien zur historischen Poetik 23), S. 31-48.
-
Erzählen vom Untergang und Beten für den Erfolg. Zur Kategorie der Stimme im Nibelungenlied und im Buch des Dede Korkut. In: S. Hartmann; K. M. Abdullayev (Hgg.): Das Nibelungenlied und das Buch des Dede Korkut. Literaturwissenschaftliche Analysen des zweiten interkulturellen Symposiums in Mainz, Deutschland, 2011. Baku; Frankfurt a.M. 2015 (Slawistische Universität Baku. Wissenschaftliche Schriften. Reihe für Sprache und Literatur. Sonderausgabe der Gemeinschaftsarbeit mit der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft), S. 74-89.
-
„Am Horizont der Dichtkunst, Brunehild“. Zu Goethes Rezeption des Nibelungenlieds. In: F. Fürbeth; B. Zegowitz (Hgg.): Vorausdeutungen und Rückblicke. Goethe und Goethe-Rezeption zwischen Klassik und Moderne. Heidelberg 2013 (Frankfurter Beiträge zur Germanistik 53), S. 165-184.
-
Spielregeln für das Überleben. Dietrich von Bern im Nibelungenlied und in der Nibelungenklage. In: Zeitschrift für deutsches Altertum 141 (2012), S. 310-334.
-
Enterbung und Gotteskindschaft. Zur Problematik der Handlungsmotivierung im ‚Willehalm‘ Wolframs von Eschenbach. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 129 (2010), S. 63-81.
Digitale Bildung und Mittelaltervermittlung
-
mit W. Ohlendorf: Die Löwenstadt als Lehr-/Lernraum. Digitale Bildung und regionale Zugehörigkeit. In: M. Baisch; M. Ratzke, R. Toepfer (Hgg.): Von Widukind zur ‚Sassine‘. Prozesse der Konstruktion und Transformation regionaler Identität im norddeutschen Raum. Wien; Köln 2023 (Forschungen zu Kunst, Geschichte und Literatur des Mittelalters 4), S. 257-277.
-
‚Das Mittelalter‘ und seine digitalen Zukunftsperspektiven. Zur open access-Strategie des Mediävistenverbands. In: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte 4 (2021), S. 65–72. DOI: https://doi.org/10.26012/mittelalter-26593
-
(mit W. Drews und M. Müller): Mittelalterforschung als gesellschaftliche und interdisziplinäre Herausforderung. Zukunftsperspektiven des Medävistenverbandes - mit einem Rückblick auf seine Geschichte. In: Das Mittelalter 26 (2021), S. 3-29. DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2021.1.24307
-
(mit I. Baumgärtner, M. Kern u. K.-H. Leven): Mittelalter erschließen. Wissenschaftskommunikation und Wissenstransfer. In: Das Mittelalter 26 (2021), S. 68-86. DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2021.1.24310
-
Germanistische Mediävistik. In: Das Mittelalter 26 (2021), S. 153-157. DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.mial.2021.1.24317
-
Wie wird ein Werk zum Klassiker? Kriterien, Probleme und Chancen mediävistischer Kanonbildung. In: R. Toepfer (Hg.): Klassiker des Mittelalters. Hildesheim 2019 (Spolia Berolinensia), S. 1-33. DOI: http://dx.doi.org/10.25716/amad-85197
-
(mit W. Ohlendorf und J. Othman): Eulenspiegel 2.0. Digitale Lehrprojekte in der germanistischen Mediävistik der TU Braunschweig. In: Eulenspiegel-Jahrbuch 2018/2019 (56/57), S. 103-129.
-
(gemeinsam mit S. Dreyfürst): Schreibdidaktik in der Germanistik. Ein mediävististisches Lehrprojekt der Goethe-Universität Frankfurt. In: Wirkendes Wort 66 (2016), S. 161-172.
-
Mediävistik für das 21. Jahrhundert. Die App ‚Frankfurt im Mittelalter. Auf den Spuren des Passionsspiels von 1492‘ aus fachwissenschaftlicher Perspektive. In: ZfdA 144 (2015), S. 274-280.
-
(gemeinsam mit S. Dreyfürst): Neue Medien in der Mediävistik. Die App ‚Frankfurt im Mittelalter. Auf den Spuren des Passionsspiels von 1492‘ – eine Projektvorstellung. 10.02.2015. http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=20163
Weiteres
-
Einleitung. In: M. Baisch; M. Ratzke; R. Toepfer (Hgg.): Von Widukind zur ‚Sassine‘. Prozesse der Konstruktion und Transformation regionaler Identität im norddeutschen Raum. Wien; Köln 2023 (Forschungen zu Kunst, Geschichte und Literatur des Mittelalters 4), S. 7-23.
-
Die tröstende Funktion der Autobiographie. Abaelards und Heloisas Briefdialog. In: R. Stauf; C. Wiebe (Hgg.): Erschriebenes Leben. Autobiographische Zeugnisse von Marc Aurel bis Knausgård. Heidelberg 2020 (GRM Beiheft 97), S. 275-293.
-
(mit T. Bulang): Einleitung. Heilssorge und Selbstsorge in Mittelalter und früher Neuzeit – Traditionen und Perspektiven. In: dies. (Hgg.): Heil und Heilung. Die Kultur der Selbstsorge in der Kunst und Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Heidelberg 2020 (GRM Beiheft 95), S. 1-17.
-
Sehen und gesehen werden. Die Blickregie im Minnesang Heinrichs von Morungen. In: M. Kern (Hg.): Imaginative Theatralität. Szenische Verfahren und kulturelle Potenziale in mittelalterlicher Dichtung, Kunst und Historiographie. Heidelberg 2013 (Interdisziplinäre Beiträge zu Mittelalter und Früher Neuzeit ), S. 53-79.
-
Oswald von Wolkenstein und sein Sprecher-Ich. Poetisches Spiel mit autobiographischen Elementen in den Liedern Kl 3, 33 und 39. In: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 19 (2012/2013), S. 225-240.
-
(gemeinsam mit R. Seidel): Einleitung. Frankfurt im Schnittpunkt der Diskurse. In: Zeitsprünge 14 (2010), S. 1-20.
Rezensionen
-
Georg Sabinus: Fabularum Ovidii interpretatio – Auslegung der Metamorphosen Ovids. Edition, Übersetzung, Kommentar, hg. von Lothar Mundt (Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext 226). Berlin; Boston 2019. In: Mittellateinisches Jahrbuch 56 (2021), S. 522-528.
-
Kitzbichler, Josefine; Stephan, Ulrike C. A. (Hgg.), Studien zur Praxis der Übersetzung antiker Literatur. Geschichte - Analysen - Kritik. Berlin; Boston 2016 (Transformationen der Antike 35). In: Arbitrium 37 (2019), S. 20-23.
-
Fugger, Dominik: Krodo. Eine Göttergeschichte. Wiesbaden 2017 (Wolfenbütteler Hefte 35). In: Zeitschrift für deutsches Altertum 147 (2018), S. 528f.
-
Marshall, Sophie: Unterlaufenes Erzählen. Psychoanalytische Lektüren zum höfischen Roman. Wiesbaden 2017 (MTU 146). In: Das Mittelalter 23 (2018), S. 211f.
-
Stadeler, Anja: Horazrezeption in der Renaissance. Strategien der Horazkommentierung bei Cristoforo Landino und Denis Lambin. Berlin; Boston 2015 (WeltLiteraturen 9). In: Zeitschrift für deutsches Altertum 147 (2018), S. 132-135.
-
Baldzuhn, Michael; Putzo, Christine: Mehrsprachigkeit im Mittelalter. Kulturelle, literarische, sprachliche und didaktische Konstellationen in europäischer Perspektive. Mit Fallstudien zu den ‹Disticha Catonis›. Berlin; New York 2011. In: Mittellateinisches Jahrbuch 49 (2014), S. 143-148.
-
Aurnhammer, Achim; Schiewer, Hans-Jochen (Hgg.): Die deutsche Griselda. Transformationen einer literarischen Figuration vom Boccaccio bis zur Moderne. Berlin; New York 2010 (Frühe Neuzeit 146). In: Zeitschrift für deutsches Altertum 142 (2013), S. 509-514.
-
Dimpel, Friedrich Michael: Die Zofe im Fokus. Perspektivierung und Sympathiesteuerung durch Nebenfiguren vom Typus der Confidente in der höfischen Epik des hohen Mittelalters. Berlin 2011 (Philologische Studien und Quellen 232). In: Zeitschrift für deutsche Philologie 132 (2013), S. 132-137.
-
Haferland, Harald; Meyer, Matthias (Hgg.): Historische Narratologie. Mediävistische Perspektiven. Berlin; New York 2010 (Trends in Medieval Philology 19). In: Zeitschrift für deutsche Philologie 132 (2013), S. 145-150.
-
Glei, Reinhold F.; Kaminski, Nicola; Lebsanft, Franz (Hgg.): Boethius Christianus? Transformationen der Consolatio Philosophiae in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin; New York 2010. In: Zeitschrift für deutsches Altertum 141 (2012), S. 500-504.
-
Meier, Christel; Ramakers, Bart; Beyer, Hartmut (Hgg.): Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit. Münster 2008 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme - Schriftenreihe des SFB 496 - Bd. 23). In: Mittellateinisches Jahrbuch 46 (2011), S. 445-451.
-
Bernuth, Ruth von: Wunder, Spott und Prophetie. Natürliche Narrheit in den 'Historien von Claus Narren'. Tübingen 2009 (Frühe Neuzeit 133). In: Germanistik 51 (2010), S. 260.
-
Washof, Wolfram: Die Bibel auf der Bühne. Exempelfiguren und protestantische Theologie im lateinischen und deutschen Bibeldrama der Reformationszeit. Münster 2007 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme / Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496 / 14). In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 132 (2010), S. 148-152.
-
Auge, Oliver; Dietl, Cora (Hgg.): Universitas. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Universität im Schnittpunkt wissenschaftlicher Disziplinen. Georg Wieland zum 70. Geburtstag. Tübingen; Basel 2007. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 131 (2009), S. 546-549.
-
Keller, Andreas: Frühe Neuzeit. Das rhetorische Zeitalter. Akademie Studienbücher Literaturwissenschaft. Berlin 2008, 231 S., 15 Abb. In: H-Soz-u-Kult, 18.06.2009. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-205
Lexikon- und Handbuchartikel
-
Simon Schaidenreisser. In: Literaturgeschichte Münchens, hg. v. W. Fromm; M. Knedlik; M. Schellong. Regensburg 2019, S. 92-97.
-
Unfruchtbarkeit/Kinderlosigkeit in der höfischen Gesellschaft: Deutungen und Wertungen der mittelalterlichen Literatur. In: Dis/ability History der Vormoderne. Ein Handbuch, hgg. v. C. Nolte; B. Frohne; U. Halle; S. Kerth. Affalterbach 2017, S. 228f.
-
Schaidenreisser (Minervius), Simon. In: Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon, hgg. v. W. Kühlmann; J.-D. Müller; M. Schilling; J.A. Steiger; F. Vollhardt, Bd. 5 (2016), Sp. 460-467.
-
Rebhun (-huhn, Perdix), Paul. In: Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon, hgg. v. W. Kühlmann; J.-D. Müller; M. Schilling; J.A. Steiger; F. Vollhardt, Bd. 5 (2016), Sp. 219-227.
-
Literatur und auditive Medien. In: H. Drügh; S. Komfort-Hein u.a. (Hgg.): Germanistik. Sprachwissenschaft - Literaturwissenschaft - Schlüsselkompetenzen. Stuttgart; Weimar 2012, S. 197-203.
-
Heinrich von Eppendorf. In: Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon, hgg. v. W. Kühlmann; J.-D. Müller; M. Schilling; J.A. Steiger; F. Vollhardt, Bd. 2 (2012), S. 228-234.
-
Hieronymus Boner. In: Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon, hgg. v. W. Kühlmann; J.-D. Müller; M. Schilling; J.A. Steiger; F. Vollhardt, Bd. 1 (2011), Sp. 336-341.
Sprechstunde
Die Sprechstunde findet im Sommersemester 2025 dienstags von 14.15–15.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich über das Schwarze Brett ÄdL zur Sprechstunde an.
Aktuelle Lehrveranstaltungen
Mediävistik als Übersetzungswissenschaft: Einführung in die ältere deutsche Literatur
Die Vorlesung gibt einen Überblick über Schlüsseltexte vom 8. bis 16. Jahrhundert und illustriert an ihnen methodische Ansätze und literaturwissenschaftliche Techniken, die für das Studium der deutschen Literatur im europäischen Mittelalter grundlegend sind. Weitere Informationen finden Sie bei WueStudy.
Geschwister in der mittelhochdeutschen Literatur
In der höfischen Literatur wachsen die Protagonisten meist als Einzelkind auf, doch wenn sie Geschwister haben, sind die Beziehungen alles andere als konfliktfrei:
Im ‚Nibelungenlied‘ lässt Gunter den Mann seiner Schwester ermorden und für Kriemhild zählt der Wunsch nach Rache mehr als die Bindung an ihre Brüder. Bei Wolfram von Eschenbach kämpft Parzival unwissentlich gegen seinen Halbbruder und ohrfeigt Willehalm seine königliche Schwester. Auch eine zu große Nähe zwischen Geschwistern kann gefährlich sein und zum Inzest führen: In Hartmanns von Aue ‚Gregorius‘ verliebt sich der Fürstensohn von Aquitanien leidenschaftlich in seine Schwester, in Albrechts von Halberstadt ‚Metamorphosen‘ wirbt Biblis inständig um die Liebe des Bruders.
Im Seminar werden Familienkonstellationen in verschiedenen mittelhochdeutschen Werken systematisch untersucht. Wie werden Geschwister dargestellt? Welche Konkurrenz- und Machtverhältnisse liegen zugrunde? Gefragt wird auch nach gattungs- und genderspezifischen Charakteristika: Inwiefern unterscheidet sich die Inszenierung im höfischen Roman von der Heldenepik und der Märendichtung? Welche Besonderheiten weisen homosoziale und heterosoziale Geschwisterbeziehungen auf?
Altgermanistisches Oberseminar
Das Oberseminar bietet fortgeschrittenen Studierenden, Doktoranden und Habilitanden Gelegenheit, ihre Projekte vorzustellen und über neuere Forschungstendenzen zu diskutieren. Interessierte sind sehr willkommen und mögen sich per Mail bei mir melden. Weitere Informationen finden Sie bei WueStudy.
Innovative Lehrprojekte (abgeschlossen)
| Lehr-Lern-Avatare. Digitales Storytelling als didaktisches Instrument am Beispiel von Till Eulenspiegel, gefördert vom BMBF im Rahmen von teach4TU, gemeinsam mit Jun.-Prof. Dr. Miriam Langlotz, bearbeitet von Jeremias Othman, M.A., Projektlaufzeit: 2019-2020. Nähere Informationen finden Sie hier. | |
 | Mittelalter-App für Braunschweig. LiteraToUr in der Stadt (‚MAppBS‘), gefördert vom BMBF im Rahmen von teach4TU, bearbeitet von Dr. Wiebke Ohlendorf, Projektlaufzeit: 2016-2017, ausgezeichnet mit dem Wissenschaftspreis Niedersachsen 2018 in der Kategorie Lehre, Transfer des Projekts in die Pharmaziegeschichte und in die Alte Geschichte der TU Braunschweig. Nähere Informationen finden Sie hier. |
Dissertationen
Laufende Projekte
-
Felix Herberth: Überlieferungsgeschichte und Autorschaftskonzept von Johannes Hartliebs ‚Histori von dem großen Alexander‘
-
Alyssa Steiner: Text, Bild, Geschlecht: Sebastian Brants Narrenkonzeption und deren Transformationen bei Thomas Murner und Johann Geiler von Kaysersberg in genderspezifischer Perspektive
-
Lea Steinfeld: Männlichkeitskonstruktionen im mittelhochdeutschen Antikenroman
-
Bianca Waldmann: Literatur als (Medium der) Erfahrung – Narrativität und Imagination in mittelhochdeutschen Erzähltexten
Abgeschlossene Projekte
-
Jennifer Hagedorn: Übersetzte Identitäten. Intersektionale Figurenkonzepte in volkssprachigen Homer-Übersetzungen des 16. Jahrhunderts (2023)
-
Manuel Hoder: Wortgewandte Wappen. Inszenierungsformen des Heraldischen in der mittelalterlichen Literatur (2023)
-
Jeremias Othman: Ritter und Ritual. Diskursivierung von Wissen in den narrativen Werken Hartmanns von Aue (2021)
-
Isabella Managó: Kontingenz in Konrads von Würzburg ‚Trojanerkrieg‘ (2020)
MA-Arbeiten
-
Das Fremde in Wirnts von Grafenberg 'Wigalois'. Die Darstellung und Inszenierung kultureller Alterität in der handschriftlichen Fassung und im Druck (2024)
-
Frauenfreundschaften im höfischen Roman? Eine Analyse ausgewählter Figurenbeziehungen (2021)
-
Freundschaft und Konkurrenz im Sängerkrieg auf der Wartburg. Eine Betrachtung der Figurenbeziehungen in literarischen Adaptationen vom Mittelalter bis in die Gegenwart (2021)
-
Idealisierte Hofdamen und kämpfende Amazonen. Die weibliche Geschlechterinszenierung im ‚Eneasroman‘ und im ‚Nibelungenlied‘ (2020)
-
Das Begehren nach Verwandtschaft. Die inzestuösen Beziehungen von Byblis, Myrrha und Gregorius (2020)
-
Keine Bösewichte? Antagonisten im ‚Eneasroman‘ und ‚Alexanderroman‘ (2020)
-
Till Eulenspiegel als Identifikationsfigur. Strategien der Rezeptionslenkung im Vergleich (2020)
-
Prekäre Identitäten. Zur Differenz von art und zuht in der Literatur des Mittelalters (2019)
-
Stand, Geschlecht und Sexualität. Überkreuzte Identitätskategorien im ‚Eneasroman‘ Heinrichs von Veldeke (2018)
Zulassungsarbeiten
-
ich wil iu getrouwen nimmer mêre. Eine Untersuchung zu epistemischer Ungerechtigkeit in der 'Kudrun' unter den Aspekten Gender und Race (2024)
-
Die Darstellung und Konzeption von weiblichen Nahbeziehungen und dem Freundschaftsbegriff in höfischer Dichtung anhand von ‚Tristan‘ und ‚Iwein‘ (2023)
BA-Arbeiten (seit 2020)
-
Marginalisierte Frauen. Eine kritische Revision weiblicher Handlungsspielräume im 'König Rother' (2024)
-
Natur und Gender in der Heldenepik (2023)
-
Rites des passage. Zur Funktion der Übergangsriten in der ‚Kudrun‘ (2023)
-
Raum und Geschlecht in Gottfrieds ‚Tristan‘ (2022)
-
Die liebende Isolde. Ein Vergleich der weiblichen Hauptfigur anhand der Minnetrank-Szene in den Werken Eilharts von Oberg, Gottfrieds von Straßburg und Martin Grzimek (2021)
-
Von der Unwissenheit des Mönches und der Listigkeit der Frauen. Gender(de)konstruktionen in mittelalterlichen Mären (2020)
-
Vom Thronfolger zum Narren. Kleidung und Identität in Eilharts Wiederkehrepisoden (2020)
-
Enites Ehre. Eine vergleichende Analyse der weiblichen Hauptfigur bei Chrétiens de Troyes ‚Erec et Enide‘ und Hartmanns von Aue ‚Erec‘ (2020)
-
Phol – Gott oder Pferd? Der zweite Merseburger Zauberspruch im europäischen Vergleich (2020)
-
Forschung zur deutschen Sprache und Literatur geht alle an. Interview mit Regina Toepfer von Sebastian Hofmann anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Instituts für deutsche Philologie, veröffentlicht am 21.11.2023, im EinBlick
-
Vielfalt Übersetzen. Sichtbarkeit und Normalisierung in der Literatur. Öffentliche Podiumsdiskussion mit Sandra Hetzl und Regina Toepfer, moderiert von Annkathrin Koppers, in Kooperation mit der Domschule Würzburg und dem SPP 2130 ‚Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit‘, 14.09.2023
-
Auf ein Wort mit Regina Toepfer. Interview des Wissenschaftsblog ‚Übersetzungsgeschichte(n)‘, von Enrica Fantino, geführt am 27.04.2023, veröffentlicht am 14.09.2023, 1. Folge und 2. Folge
-
Essayschreiben und übersetzen mit Regina Toepfer. 3. Folge von ‚Neu & Veröffentlicht‘ einer Reihe des mediävistischen Podcast der Ruhr-Universität Bochum (08.09.2023, Dauer: 30:38min)
-
Ein immer neuer Blick aufs Mittelalter. Interview mit Regina Toepfer als Präsidentin des Mediävistenverbands von Gunnar Bartsch anlässlich des 40-jährigen Verbandsjubiläums, veröffentlicht am 23.05.2023
-
Bühnenreifes Weihnachtsfest? Über den ewigen Zauber des Krippenspiels. Regina Toepfer bei NDR-Info ‚vertikal horizontal / Aus Kirche und Gesellschaft‘, Redaktion: Alexa Hennings und Florian Breitmeier (18.12.2022, Dauer: 32:46 Min)
-
Ozeanisch Schreiben – Ein Dialog in vierter Dimension. Mit Thomas Meinecke, Carolin Bohn, Regina Toepfer, Bettina Wahrig. Live übertragen am 15.12.2022
-
'Jungfrau': Religiöse Texte queer lesen. Gespräch zwischen Thomas Meinecke und Regina Toepfer. Aufgezeichnet am 20. Juni 2019 in der Buchhandlung Graff. In: Carolin Bohn; Thomas Meinecke; Regina Toepfer; Bettina Wahrig: Ozeanisch schreiben. Drei Ensembles zu einer Poetik des Nicht-Binären. Berlin 2022, S. 59-89.
-
Kinderlosigkeit im Mittelalter. Regina Toepfer in der Redezeit bei WDR 5 Neugier genügt - Redezeit. Redaktion: Chris Hulin / Lioba Werrelmann, Moderation: Achim Schmitz-Forte (27.12.2021, Dauer: 23:01 Min)
-
Übersetzen ist Macht. Geheimnisse, Geschichten, Geschenke in der Frühen Neuzeit – Digitale Ausstellung des DFG-Schwerpunktprogramms 2130 'Übersetzungskulturen der Frühen Neuzeit'
-
Übersetzen ist Macht – Talk zur Ausstellungseröffnung mit Olga Grjasnowa, YouTube (02.12.2021)
-
Was uns das Mittelalter heute zu sagen hat. Vorstellung von Regina Toepfer in der 25. Ausgabe des Online-Magazins der Universität Würzburg 'einBLICK' von Gunnar Bartsch (6. Juli 2021)
-
Neu an der Uni. Zweiminütiges Interview mit Regina Toepfer auf dem Youtube-Kanal der Universität Würzburg (29. Juni 2021)
-
30. Folge des Coffeetalks von 'Pergament und Mikrofon', dem mediävistischen Podcast der Ruhr-Universität Bochum, mit Regina Toepfer (30. April 2021)
-
Kinderlosigkeit - Traum statt Trauma? Talk zur Buchveröffentlichung von "Kinderlosigkeit: Ersehnte, verweigerte und bereute Elternschaft im Mittelalter", YouTube (18.11.2020)