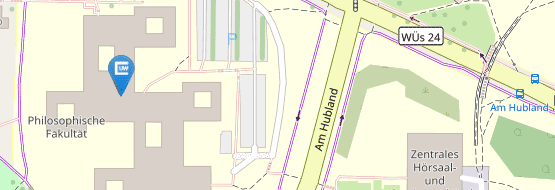Bericht | Judith Schalansky: Von abgelegenen Inseln, garstigen Biologielehrerinnen und verzeichneten Verlusten (9. Juli 2025)
»Ich habe mir die Geschichten nicht ausgedacht. Ich kann mir nämlich gar nichts ausdenken.« Mit diesem Zitat überrascht Judith Schalansky nach dem Vortrag zweier Texte aus ihrem Atlas der abgelegenen Inseln den mit 150 Gäst*innen vollbesetzten Gartenpavillon des Würzburger Juliusspitals. Vielmehr fische sie im Bereich zwischen Fakt und Fiktion. Deshalb kann sie mit Leichtigkeit Geschichten von und über Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde – so der Untertitel des Atlas – schreiben.
»Ich habe mir die Geschichten nicht ausgedacht. Ich kann mir nämlich gar nichts ausdenken.«
Was Schalansky mithin über den Mikrokommunismus auf der Insel Tristan da Cunha im Atlantik oder in der Kolportage des Schiffbruchs eines englischen Postschiffs 1871 vor der Sankt-Paul-Insel im Indischen Ozean schreibt, ist alles, wie sie sagt: »Forschung ohne Fußnoten«. Die beiden Texte aus dem Atlas trägt sie denn auch erst nach einem unterhaltsamen Bericht über die Arbeit an dem Buch und Reflexionen auf das Verhältnis von Objektivität und Ideologie im Medium Atlas vor.
»Forschung ohne Fußnoten«
Den ideologischen Gehalt von Atlanten führt sie an einem Atlas aus ihrer Kindheit in der DDR vor: Darin eine Doppelseite, die die DDR und die BRD zeigt – beide so angeordnet, dass der Buchfalz sie trennt, wobei ein Teil der BRD in seinem Abgrund verschwindet. Dass die DDR schweinchenrosa und die BRD grau eingefärbt ist, nimmt nicht wunder.
Farben sind für die Buchgestalterin Schalansky aus einem anderen Grund von großer Bedeutung: buchgestalterische Ästhetik. So erläutert Schalansky die gestalterischen Farbprinzipien des großformatigen Atlas der abgelegenen Inseln im Vergleich zur hosentaschenkleinen Taschenatlas-Ausgabe und warum sie etwa das Taubengraublau des großen Formats für das Kleinformat durch ein »David-Hockney-Blau« ersetzt hat.
Taubengraublau vs. »David-Hockney-Blau«
Apropos Blau. Den vorgetragenen Text aus dem Verzeichnis einiger Verluste, »Der Knabe in Blau«, wählt Schalansky mit erstaunlicher Spontaneität am Lesepult aus: Sie zeigt sich befremdet von der Farbe der Decke des Gartenpavillons des Juliusspitals, in dem das Werkstattgespräch stattfindet. Gemeinsam mit dem Publikum befindet sie, dass es sich dabei um eine Art Lachsrosa handelt. Was sie wiederum an die leitmotivische Farbe in der Greta-Garbo-Geschichte »Der Knabe in Blau« erinnert: Gammelrosa.
»Kann eine Schriftart gewaltvoll/politisch sein?«
Neben Farben sind für Schalansky Schriftarten von zentraler Bedeutung. Dementsprechend beginnt sie den Abend überhaupt mit einer Vorstellung ihres Buches Fraktur mon Amour, in dem sie über 300 verschiedene Fraktur-Schriftarten vorstellt. Die Frage »Kann eine Schriftart gewaltvoll/politisch sein?« liegt dabei nahe, sind Frakturschriftarten doch nach wie vor als ›Nazischrift‹ übel beleumundet – ein Ressentiment, das Schalansky auch fast 20 Jahre nach Erscheinen von Fraktur mon Amour nicht müde wird zu bekämpfen.
»Man sah ihnen die sechs Wochen Gammelei an. Die Bücher hatte keiner von denen aufgeschlagen. Große Ferien.«
Ressentiment prägt auch eine andere Hauptfigur des Abends: Inge Lohmark, Biologielehrerin und Protagonistin des ›Bildungsromans‹ Der Hals der Giraffe. Gerade als Literaturwissenschaftler*innen wollen wir nie von der Figur auf die Autorin schließen, Inge Lohmark und Judith Schalansky eint aber eine Fähigkeit: Beide haben ihr Publikum im Griff. Wenngleich auf sehr unterschiedliche Weisen. Schalansky mit sichtlicher Freude am Performen, bemerkenswerter Spontaneität und nachgerade kabarettistischem Talent.
Lohmark hingegen mit beinharter Autorität: »›Setzen‹, sagte Inge Lohmark, und die Klasse setzte sich. Sie sagte ›Schlagen Sie das Buch auf Seite sieben auf‹, und sie schlugen das Buch auf Seite sieben auf«, wie Der Hals der Giraffe einsetzt. Ist Lohmarks pädagogische Maxime doch: »Für die Schüler war es ohnehin das Beste, sie in jedem Moment spüren zu lassen, dass sie ihr ausgeliefert waren. Anstatt ihnen vorzugaukeln, sie hätten irgendetwas zu sagen.«
 |  |
(Andreas Lugauer)
Über die Autorin
Judith Schalansky (*1980 in Greifswald) lebt als freie Schriftstellerin und Buchgestalterin in Berlin. Sie studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign in Berlin und Potsdam. Ihr literarisches Debüt feierte sie 2008 mit dem Roman Blau steht dir nicht. Schalansky hat mehrere ihrer Bücher selbst gestaltet und dafür Designpreise erhalten; die Stiftung Buchkunst zeichnete sowohl ihren literarisch-kartografischen Atlas der abgelegenen Inseln (2009) als auch den Roman Der Hals der Giraffe (2011) mit dem 1. Preis als »Schönstes deutsches Buch des Jahres« aus. Beide Titel wurden bereits mehrfach auf deutschen Theaterbühnen inszeniert. Darüber hinaus erlangte sie internationale Bekanntheit durch die Übersetzung ihrer Werke in mehr als 20 Sprachen. 2024 fand in Paris die erste internationale Tagung zu Judith Schalanskys Werken statt. Seit 2013 ist sie die Herausgeberin der Buchreihe Naturkunden (Matthes & Seitz, Berlin). Im Jahr 2019 übernahm sie gemeinsam mit Karl Ove Knausgård die Poetik-Dozentur der Universität Tübingen. Im Juli 2025 hat sie die Frankfurter Poetikdozentur inne.
Eine Auswahl ihrer Auszeichnungen:
2012: Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises der Stadt Bad Homburg
2014: Mainzer Stadtschreiberin
2014: Preis der Literaturhäuser
2018: Irmtraud-Morgner-Literaturpreis
2018: Wilhelm-Raabe-Preis für Verzeichnis einiger Verluste
2020: Nicolas-Born-Preis
2020: Premio Strega Europeo für Verzeichnis einiger Verluste
2021: Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig
2022: Carl-Amery-Literaturpreis
2023: Wortmeldungen-Literaturpreis für das Essay Schwankende Kanarien